Vergangene Veranstaltungen
NarraMuse-Seminar 2023-2024: „Die postmigrantische Wende: Herausforderungen und Fragestellungen einer angekündigten sozio-kulturellen und religiösen Veränderung“
Anlässlich einer Fernsehtalkshow, die am 8. Mai 1998 ausgestrahlt wurde, übernahm der deutschsprachige Schriftsteller Feridun Zaimoglu—geboren 1964 in der Türkei und in jungen Jahren mit seiner Familie nach Deutschland gekommen—die Rolle des Sprechers der neuen Generationen mit ausländischer Herkunft. Nach „vierzig Jahren Migrationsgeschichte“ in Europa wollten diese jungen Generationen nicht länger in die Falle einer Identität als „Krisenkreaturen“ gelockt werden, die angeblich zwischen Herkunftskulturen und den Kulturen der Aufnahmegesellschaften hin- und hergerissen sind.
Fünfundzwanzig Jahre später definiert die Politikwissenschaftlerin Naika Foroutan, nach der Veröffentlichung ihres Buches Die postmigrantische Gesellschaft (2019), die Herausforderungen der «postmigrantischen Gesellschaft» über die immer noch lebhaften Diskussionen zur Migration selbst hinaus. Auf eine viel allgemeinere Weise betrifft der „Kernkonflikt“ postmigrantischer Gesellschaften, so schreibt sie, nur oberflächlich die Frage der Migration. Viel mehr betrifft er die „Verhandlung und Anerkennung von Gleichheit als zentrale Verheißung moderner Demokratien, die Vielfalt und Parität als grundlegendes Prinzip anrufen», auch in Bezug auf zum Beispiel muslimischstämmige Bevölkerungsgruppen“.
Jüngste Forschungen, wie die von Moritz Schramm und seinem Forschungszentrum der Syddansk Universitet (University of Southern Denmark), das sich auf die eingehende Untersuchung der Postmigration spezialisiert hat, betonen die Notwendigkeit, diesen Begriff zu entklammern, indem sie die Idee der (migranten und postmigranten) „Generationen“ übergehen und ihn in das Konzept einer „postmigrantischen Perspektive“ integrieren, die in den Gesellschaften insgesamt wirksam ist.
Das transversale interuniversitäre Seminar der Doktorand*innen-Schule für Sprachen und Literatur des F.R.S.-FNRS hat zum Ziel, die Modalitäten dieser postmigrantischen Perspektive im Hinblick auf einige Fragestellungen zu definieren, von denen wir hier eine nicht erschöpfende Liste vorschlagen:
- Identitäten und Gender
Eine der Stärken des Konzepts der Postmigration ist genau, dass es sich auf die Komplexität moderner Gesellschaften ausdehnen kann, einschließlich der Ambivalenzen, der Mehrdeutigkeiten, der Antagonismen und dem Aufkommen neuer Allianzen und Solidaritäten jenseits der Begriffe Ethnizität, Gender oder kulturelles Erbe. (Foroutan 2019). Was die sogenannten „weiblichen“ und nicht-binären Identitäten betrifft, scheint der Fokus auf dem Wunsch nach Bestätigung und Sichtbarkeit einer multiplen Identität in einer Gesellschaft „der Aufnahme“ und „der Herkunft“ zu liegen, die auf im Wesentlichen dualistischen Strukturen basieren (Aydemir & Yaghoobifarah 2022). Unter den vielen Facetten der Identität des „pluralen Menschen“ (Lahire 2016) entstehen verschiedene Ausdrücke männlicher Identität. Die Wahrnehmungen und Ausprägungen der Männlichkeit betreffen Machtverhältnisse (Delphy 2008), die Übermittlung von „legitimen“ Emotionen und Lebensweisen (Hooks 2021), die Rollenteilung (Bourdieu, 1990) und soziale sowie wirtschaftliche Ungleichheiten (Delphy 2016).
- Frage des Verhältnisses zum Körper
Die Frage des Körpers ist ein wesentlicher Bestandteil der postmigrantischen Erfahrung. Obwohl das postmigrantische Subjekt in Europa geboren und erzogen wurde, scheint es, dass dieses Subjekt – oder genauer gesagt, sein Aussehen – und noch mehr seine aktive Sichtbarkeit (als Bedingung der Möglichkeit zu existieren, vgl. Göle, 2015) häufig als „Anderes“ kategorisiert wird, sowohl von der europäischen Gesellschaft (Aydemir & Yaghoobifarah 2022) als auch im Rahmen der ersten Migrantengeneration innerhalb der Familie. Ohne jedoch in eine Pathologisierung zu verfallen, scheint der Körper des postmigrantischen Subjekts weder in die Normen der europäischen Gesellschaft, einschließlich der informellen Normen, noch in die des „Herkunftslandes“ zu passen. Insbesondere durch die Möglichkeit des Aufkommens dieses „fluiden“ Aussehens zielt die postmigrantische Perspektive darauf ab, jede Art von binären Oppositionspaaren infrage zu stellen, die bisher die hegemoniale Normalität bestimmt haben (Yildiz 2022).
- Neubewertung der Zugehörigkeitsmodalitäten
Der Begriff der Zugehörigkeit ist für das postmigrantische Subjekt oft problematisch, sei es im Zusammenhang mit persönlichen Überlegungen—mit Schwierigkeiten, „loszulassen, ohne aufzugeben“, oder auch „sich zu verankern, ohne gefangen zu bleiben“ (Fleury 2020)—und/oder gesellschaftlichen Positionen. Es stößt tatsächlich auf Diskurse, die es marginalisieren und es in der Gesellschaft, in der es geboren wurde, „migrantisieren“ (Petersen, Schramm und Wiegand 2019). Es zeigt die Grenzen der auf dem Nationalstaat basierenden Modelle der Zugehörigkeit auf, die immer eine Bindung an ein Territorium, eine Kultur oder ein Land privilegieren (Nouss 2015). Nouss fordert eine Neubewertung dieser Modelle, um die Mehrfachzugehörigkeit zu denken; dies erscheint umso notwendiger, als in stark säkularisierten Gesellschaften, in denen religiöser Indifferentismus vorherrschend geworden ist (Donégani 2015), die Berücksichtigung der religiösen Dimension in identitätskonstituierenden Prozessen schwierig erscheint: als Fremdheit wird sie oft hinterfragt, minimiert oder sogar marginalisiert, es sei denn, sie wird von vornherein als Problem betrachtet.
- Trauma Studies und Fragen der Erinnerung
Die Trauma Studies haben gezeigt, dass im Fall der Migration das Trauma nicht mit dem Ende der Reise selbst endet, sondern das Individuum dauerhaft beeinflusst, wodurch es auch Auswirkungen auf das Leben hat, das es im Gastland führt (de Rogatis 2023), sowie auf das Leben seiner Kinder, insbesondere wenn die kulturelle Weitergabe nicht ausreichend gesichert scheint. Der Prozess erstreckt sich über die Zeit (von einer Generation zur nächsten) und den Raum (von der/den Abreisegemeinschaft(en) zur Ankunftsgemeinschaft(en)). Marianne Hirsch definiert Postgedächtnis als die Beziehung der zweiten Generation zu intensiven, oft traumatischen Erfahrungen, die vor ihrer Geburt stattgefunden haben, aber ihnen mit solcher Intensität übermittelt wurden, dass sie wie ihre eigenen Erinnerungen erscheinen. Auch wenn das Postgedächtnis im Kontext des Holocausts konzipiert wurde, betont Hirsch selbst, dass diese inter- und transgenerationalen Strukturen (Hirsch 1996) auf viele Kontexte des traumatischen Transfers anwendbar sind (Hirsch 2012), einschließlich der Migration und damit der Postmigration.
- Bezüge zum Postkolonialismus
Postmigration und Postkolonialismus verlangen beide nach einer Lesart, die sich nicht auf einen rein chronologischen Sinn beschränkt – die Zeit nach der Kolonisierung, die Zeit nach der Migration. Sie verweisen vor allem auf eine kritische Perspektive, die darauf abzielt, binäre Gegensätze zwischen Kulturen zu überwinden – Kolonisator/Kolonisiert, Einheimischer/Migrant (Yildiz 2022). In beiden Fällen richtet sich diese Perspektive vor allem auf Phänomene der Dominanz und des Widerstands gegen diese Dominanz: Sie erkennt in postkolonialen und postmigrantischen Werken Strategien zur Sichtbarmachung und Dekonstruktion dualistischer Weltanschauungen.Dadurch treffen sich Postkolonialismus und Postmigration auch in einer Auseinandersetzung mit den Bedingungen kultureller Vielfalt.
- Ethik der Anerkennung
Im Rahmen der Arbeiten, insbesondere des Philosophen Axel Honneth, thematisieren die Überlegungen zur Ethik der Anerkennung, dass Individuen vor allem danach streben, in ihrer Individualität anerkannt zu werden (u. a. durch Liebe, Recht oder Solidarität, vgl. Honneth 1992). Diese Anerkennungsbestrebungen stoßen jedoch auch auf verschiedene Formen der Missachtung. Auch wenn in demokratischen und postmigrantischen Gesellschaften (Foroutan 2019) grundsätzlich alle das Recht zu haben scheinen, eine gleichberechtigte Anerkennung zwischen Personen einzufordern, wird dieses Streben paradoxerweise immer unstillbarer – unter anderem, weil Anerkennung zunehmend vom Blick abhängig zu sein scheint, den andere auf eine*n richten (Fukuyama 2018), oder weil sie an Aspekte symbolischer Anerkennung gekoppelt ist. Daraus können Ressentiments entstehen – in Verbindung mit als Demütigung oder Nichtanerkennung erlebten Situationen –, die jedoch durch Bildung, das, was Foucault als „Regierung des Selbst“ bezeichnet, oder durch eine Fähigkeit zur Sublimierung (Fleury 2020) entgegengewirkt werden können.
- Multimediale Erzählformen und alternative Verbreitungsnetzwerke
Postmigrant*innen sind häufig Digital Natives, die neue Technologien nutzen, um die Kontexte, in denen sie sich bewegen, zum Ausdruck zu bringen. Durch den Einsatz neuer Technologien gelingt es ihnen, traditionelle Formen der literarischen bzw. künstlerischen Kommunikation zu umgehen. Viele begannen ihre Karriere, indem sie auf Webseiten oder in sozialen Netzwerken schrieben oder ihre Werke über Plattformen wie Spotify, YouTube oder Vimeo verbreiteten. Dadurch konnten sie spezifische Schreibkompetenzen (Sprache, künstlerische und narrative Strategien) entwickeln, die ihre besonderen Lebensrealitäten ausdrücken. Besonders interessant ist das Phänomen des Rap in Europa, das maßgeblich von Migrant*innen und Postmigrant*innen geprägt ist. Die Geschichten, die Rapper*innen erzählen, richten sich an ein breites – meist urbanes – Publikum, das junge Menschen aus unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Hintergründen umfasst. Postmigrantische Rapper*innen schaffen damit alternative Anerkennungsnetzwerke, die sich von der traditionellen Literatur deutlich abgrenzen.
- Postmigrantische Literatur und Intersektionalität
Die postmigrantische Perspektive zielt darauf ab, migrationsbezogene Diskurse als getarnte Marker rassistischer Ausgrenzung zu überwinden und Migration stattdessen als gesellschaftliche Normalität zu begreifen (Foroutan 2019). Diese Kritik überschneidet sich mit dem intersektionalen Ansatz, der ursprünglich von afroamerikanischen Feminist*innen entwickelt wurde und davon ausgeht, dass sich verschiedene Formen sozialer Ausgrenzung wechselseitig beeinflussen (Crenshaw 1989). Ähnlich wie die Intersektionalität ermöglicht auch die postmigrantische Perspektive eine Analyse der Verschränkung unterschiedlicher sozialer Machtverhältnisse. Ziel ist es, diese kritisch zu hinterfragen und zu dekonstruieren – auf Grundlage der Anerkennung von Migration als soziale Normalität.
- Idee der Belastung, der Verhandlung
In einer politischen Gesellschaft, die um das Imperativ der Singularität organisiert ist, erscheint die Postmigration nicht als eine bevorzugte Situation/ein Zustand, um zu analysieren, wie die Gesellschaft strukturell eine bestimmte Art von Individuum erschafft? In der Tat, welche „Belastungen“ treten vor allem in den Erzählungen und (Auto-)Biografien von postmigrantischen Personen auf und welche Bedeutungen werden ihnen zugewiesen? Wenn Danilo Martuccelli (vgl. Allouani 2007) „Belastungen“ als „gemeinsame historische strukturelle Herausforderungen“ versteht, denen sich „Individuen“ mit ihren eigenen Mitteln stellen müssen, wie sprechen sie darüber? Wie zeugen die Erzählweisen dieser Belastungen außerdem von mehr oder weniger dissonanten eingebauten Dispositionen und mehr oder weniger widersprüchlichen relationalen Kontexten? Mit denen das Individuum verhandelt, um einen für sich selbst gerechteren Lebensweg zu konkretisieren, während es gleichzeitig am Aufbau des Gemeinsamen arbeitet?
Bibliographie
ALLOUANI, Zakia. 2007 D. Martucelli. Forgé par l’épreuve. L’individu dans la France contemporaine. L’orientation scolaire et professionnelle, 36(2). http://journals.openedition.org/osp/1425. Mis en ligne le 08 décembre 2009, consulté le 17 février 2014.
AYDEMIR, Fatma, & YAGHOOBIFARAH, Hengameh. (2022). Eure Heimat ist unser Albtraum. 5. Auflage. Berlin: Ullstein.
BOURDIEU, Pierre. 1990. La domination masculine. Actes de la recherche en sciences sociales, 84(1), pp. 2-31.
CRENSHAW, Kimberlé. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, 1, pp. 139-168.
DE ROGATIS, Tiziana. (2023). Homing/Ritrovarsi: Traumi e translinguismi delle migrazioni in Morante, Hoffman, Kristoff, Scego e Lahiri. Università per Stranieri di Siena.
DELPHY, Christine. (2008). Classer, dominer: qui sont les «autres»? Paris: La fabrique éditions.
DELPHY, Christine. (2016). Close to home: A materialist analysis of women’s oppression. Londres: Verso Books.
DONEGANI, Jean-Marie. (2015).La sécularisation du croire: pragmatisme et religion. Archives de sciences sociales des religions, 169, pp. 229-261.
FLEURY, Cynthia. (2020). Ci-gît l’amer – Guérir du ressentiment. Paris: Gallimard.
FOROUTAN, Naika. (2019). Die postmigrantische Gesellschaft: Ein Versprechen der pluralen Demokratie. Bielefeld: transcript.
FUKUYAMA, Francis. (2018). Identity – Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition. Londres: Profile Books Ltd.
GÖLE, Nilüfer. (2015). Musulmans au quotidien – Une enquête européenne sur les controverses autour de l’islam. Paris: La Découverte.
HIRSCH, Marianne. (1996). Past Lives: Postmemories in Exile. Poetics Today, 17(4), pp. 659–86. https://doi.org/10.2307/1773218.
HIRSCH, Marianne. (2012). The Generation of Postmemory : Writing and Visual Culture after the Holocaust. New York: Columbia University Press.
HONNETH, A. (2008). La lutte pour la reconnaissance. Paris: Cerf.
HOOKS, Bell. (2021). La volonté de changer: les hommes, la masculinité et l’amour. Paris: Divergences.
LAHIRE, Bernard. (2016). L’homme pluriel. La sociologie à l’épreuve de l’individu. In Catherine Halpern (éd.), Identité(s): L’individu, le groupe, la société (pp. 57-67). Auxerre: Éditions Sciences Humaines.
NOUSS, Alexis. (2015). La Condition de l’exilé. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
PETERSEN, Anne Ring, SCHRAMM, Moritz, & WIEGAND, Frauke. (2019). Introduction: From Artistic Intervention to Academic Discussion. In Moritz Schramm et al., Reframing Migration, Diversity and the Arts: The Postmigrant Condition (pp. 3-10). New York/Londres: Routledge.
YILDIZ, Erol. (2022). Vom Postkolonialen zum Postmigrantischen: Eine neue Topografie des Möglichen. In Ömer Alkin & Lena Geuer (éds.), Postkolonialismus und Postmigration (pp. 71-98). (HG.) Münster: Unrast Verlag.
Programm
Tag 1
9. Februar 2024, von 10 bis 17 Uhr
Salle Oleffe (Bâtiment des Halles universitaires, Place de l’université 1)
9:30 Uhr — Willkommen und Kaffee
10:00 Uhr — Moritz Schramm (University of Southern Denmark), « Postmigration and the reflexive turn in Migration Studies »
11:30 Uhr — Arvi Sepp (VUB), « On the Dynamics of Exchange and the Permeability of Borders: Conceptual Reflections on Literary ‘Transculturalism’ »
12:30 Uhr — Mittagspause
14:00 Uhr — Núria Codina (PI), Marialena Avgerinou, Anna Sofia Churchill, Joana Roqué Pesquer, Sonja Ruud(KULeuven), « Presentation of the COLLAB ERC Starting Grant Project: Making Migrant Voices Heard Through Literature: How Collaboration is Changing the Cultural Field »
15:00 Uhr — Hubert Roland, Costantino Maeder, Brigitte Maréchal, Gloria Coscia, Amaury Dehoux, Naïma El Makrini, Serena Finotello, Letizia Sassi (UCLouvain), « Practicing interdisciplinarity between humanities and social sciences on a daily basis: the case-study of the NarraMuse-project (Writing the Self and the Other: Identity and Societal Issues in Post-migration Literatures of Muslim descent in French, German and Italian) »
16:00 Uhr — Podiumsdiskussion und Austausch mit den Doktorand·innen (FR/ENG)
17 :00 Uhr— Abschluss der Arbeiten
Tag 2
10. Mai 2024, von 10 bis 16 Uhr
Salle Oleffe (Halles universitaires, Place de l’université 1)
9:30 Uhr — Willkommen und Kaffee
10:00 Uhr — Tiziana De Rogatis (University for Foreigners of Siena), « Postmigration, translingualism and homing in Igiaba Scego and Jhumpa Lahiri »
11:00 Uhr — Gabriele Marino (University of Turin), « Migrant words and sounds in Italy — Between rap, trap, and afrobeats »
12:00 Uhr — Mittagspause
14:00 Uhr — Anita Rotter (Universität Innsbruck), « German Rap and Slam Lyrics in the Postmigrant Society »
15:00 Uhr — Diskussion mit den Doktorand·innen (FR/ENG) und Abschluss der Arbeiten
Tag 3
13. Mai 2024, von 10 bis 16 Uhr
ULB (AY2.114)
9:30 Uhr — Willkommen und Kaffee
10:00 Uhr — Ibrahima Diagne (Université Cheikh Anta DIOP), « Postmigration, Decolonial Experiences, and Transnational Poetics »
11:00 Uhr — Justine Feyereisen (Universiteit Gent), « What Migration? Utopia and Parrehsia with Soeuf Elbadawi »
12:0 Uhr — Myriam Geiser (Université Grenoble Alpes), « The Notion of Post-migration as a Literary Category from a Franco-German Perspective »
13:00 Uhr — Mittagspause
14:00 Uhr — Lily Climenhaga (Universiteit Gent), « A Postmigrant Theatre of the Future: Migratory Aesthetics, Globalized Realism, and Intercultural Interlocutors in the Theatre of Milo Rau »
15:00 Uhr — Diskussion mit den Doktorand·innen (FR/ENG) und Abschluss der Arbeiten
Wissenschaftliche Vormittag „Identitäten, Zugehörigkeiten und kulturelle Produktionen im Zeitalter der Postmigration“ – 07.06.2023
Der Studientag, die 3. Sitzung des Frühjahrsseminars des ARC NarraMuse, findet am Mittwoch, den 7. Juni, von 9:00 bis 12:00 Uhr im Salle Ladrière (Collège Mercier, 1. Etage, Place Cardinal Mercier) statt.
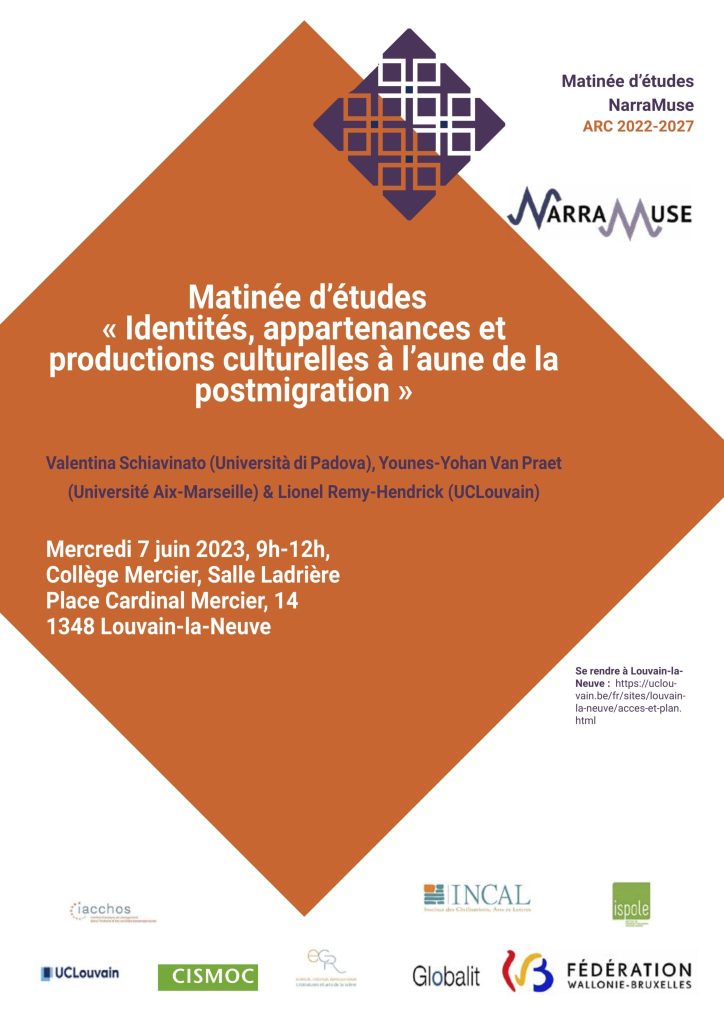
Programm
9:00 Uhr — Empfang der Teilnehmer:innen
9:30 Uhr — Valentina Schiavinato (Università di Padova): « La double présence: jeunes italo-marocain·e·s entre processus d’altération et valorisation des compétences »
10:00 Uhr — Diskussion
10:10 Uhr — Younes-Yohan Van Praet (Université Aix-Marseille): « Religiosités musulmanes: entre continuité et ruptures »
10:40 Uhr — Diskussion
10:50 Uhr — Pause
11:00 Uhr — Lionel Remy-Hendrick (UCLouvain): « Le principe d’authenticité. Refonder le groupe par la co-énonciation dans la pratique du rap »
11:30 Uhr — Diskussion mit den drei Referent*innen
12:00 Uhr — Abschluss
Studientag „Europäische Literatur der Postmigration: Theorie und Kartographie“ — 23.05.2023
Der Studientag, die zweite Sitzung des Frühlingsseminars des ARC NarraMuse, findet am 23. Mai 2023 von 10:00 bis 17:30 Uhr im MORE54 statt.
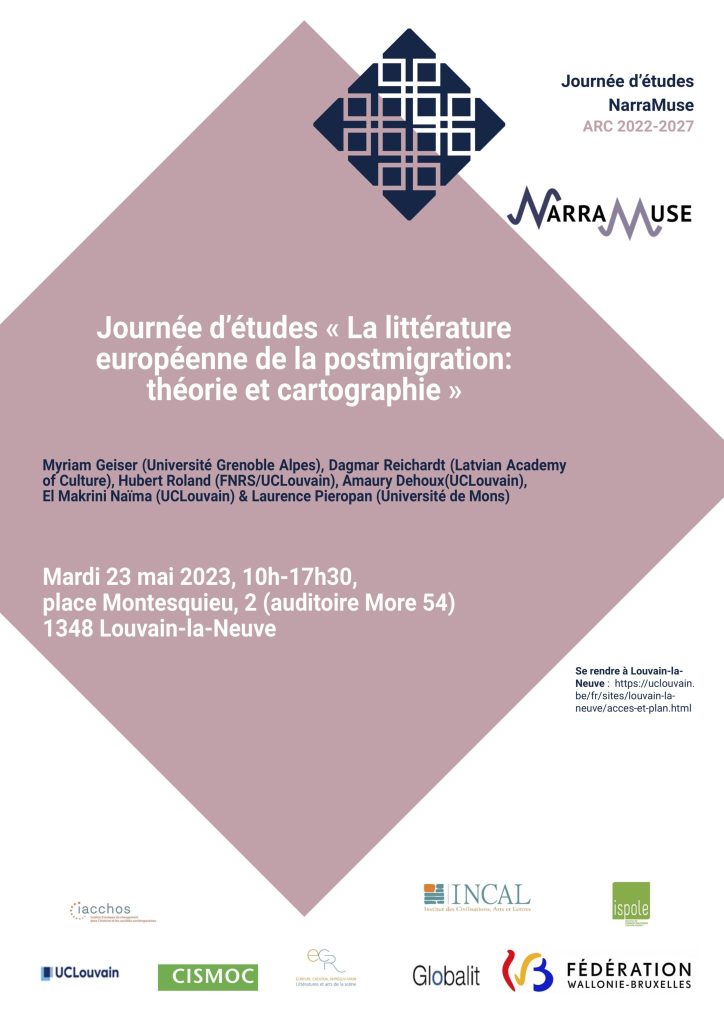
Programm
9:30 Uhr — Begrüßung der Teilnehmenden
Session 1: Postmigration und Theorien
10:00 Uhr — Myriam Geiser (Université Grenoble Alpes): „Positionnements théoriques à l’ère des “post”: Corrélations entre les concepts de post-mémoire et de post-migration“
10:45 Uhr — Diskussion
11:15 Uhr — Kaffeepause
11:45 Uhr — Dagmar Reichardt (Latvian Academy of Culture): „Transculturalism – Heading for a New Postmigration Era“
12:30 Uhr — Diskussion
13:00 Uhr — Mittagspause
Session 2: Literatur der Postmigration in Italien und Deutschland
14:00 Uhr — Dagmar Reichardt (Latvian Academy of Culture): „Transcultural Labs & Italophonia: Selected Case Studies of Fluidity and Viscosity in Postmigration Literary Discourses“
14:30 Uhr — Hubert Roland (FNRS/UCLouvain): „Ethos und Anerkennung in den literarischen Produktionen postmigrantischer Autor*innen auf Deutsch“
15:00 Uhr — Diskussion
15:30 Uhr — Kaffeepause
Session 3: Literatur der Postmigration in Frankreich und Belgien
16:00 Uhr — Naïma El Makrini (UCLouvain) und Amaury Dehoux (UClouvain): „Quelques tendances de la production littéraire postmigrante en France“
16:30 Uhr — Laurence Pieropan (Université de Mons): „La littérature migrante en Belgique francophone: un sous-champ littéraire?“
17:00 Uhr — Diskussion
17:30 Uhr — Abschluss
Vortrag von Martina Kopf — 26.04.2023
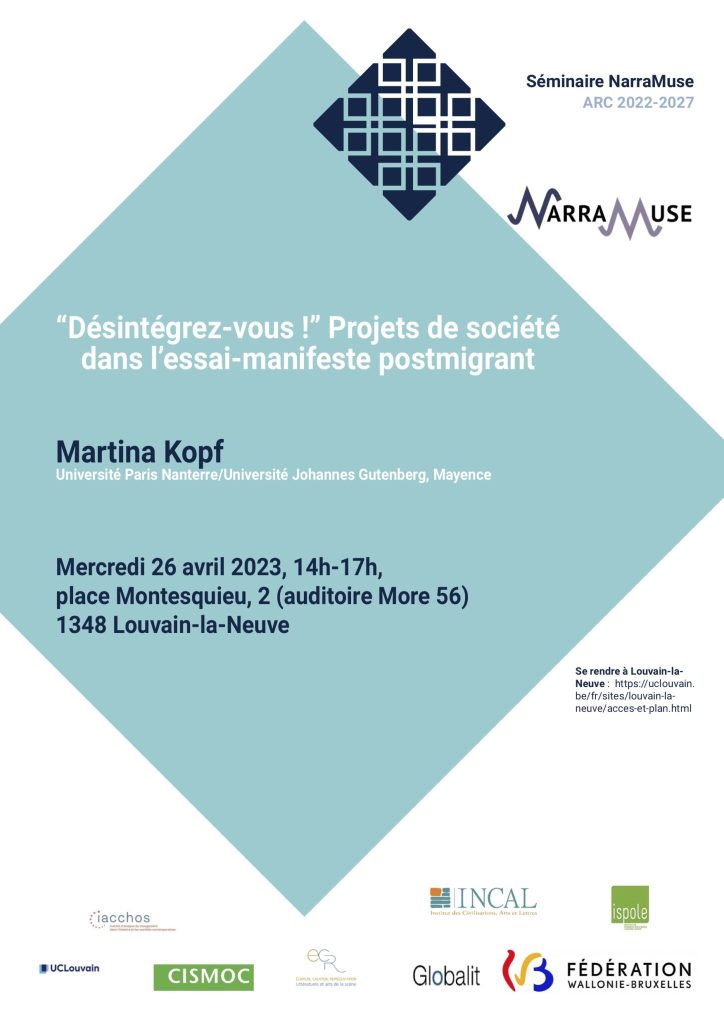
Die erste Sitzung des Frühlingsseminars des ARC NarraMuse findet am Mittwoch, den 26. April 2023, von 14:00 bis 17:00 Uhr im Hörsaal MORE 56 (Place Montesquieu, 2) statt.
Dieser Zyklus wird mit einem Vortrag von Martina Kopf (Johannes Gutenberg-Universität Mainz/Université Paris Nanterre) eröffnet: „Désintégrez-vous ! Projets de société dans l’essai-manifeste postmigrant“.
In den letzten Jahren wurden mehrere Essays oder Essaysammlungen veröffentlicht, die oft die Form von Manifesten annehmen, in denen Autor*innen die Gesellschaft und die politische Welt kritisieren, während sie gleichzeitig postmigrantische Gesellschaftsprojekte entwerfen. Interessanterweise sind diese Essays und Manifeste sowohl in Deutschland (Max Czollek, Fatma Aydemir, Hengameh Yaghoobifarah, Ilija Trojanow, Navid Kermani) als auch in Frankreich (Patrick Chamoiseau, Michel le Bris, Édouard Glissant) entstanden. Der Fokus wird auf eine vergleichende Betrachtung dieser Essays und ihrer jeweiligen Gesellschaftsprojekte gelegt, die hauptsächlich durch die Konzepte „postmigrantische Gesellschaft“ und „postmigrantische Perspektive“ angesprochen werden.
Launching Event — 13/12/22, 17:00–19:00
Das NarraMuse-Forschungsteam lädt Sie herzlich zur Eröffnung seines interdisziplinären Projekts der Konzertierten Forschungsaktion (ARC 2022–2027) ein.
Dienstag, 13. Dezember 2022, 17:00–19:00
UCLouvain
Sénat académique, Halles Universitaires
Place de l’université 1
17:00 Uhr : Begrüßung der Teilnehmenden
17:10 Uhr : Projektvorstellung
18:10 Uhr : Auszüge aus ausgewählten Texten: Lesung und Kommentierung
18:45 Uhr : Empfang
