Kommende Veranstaltungen
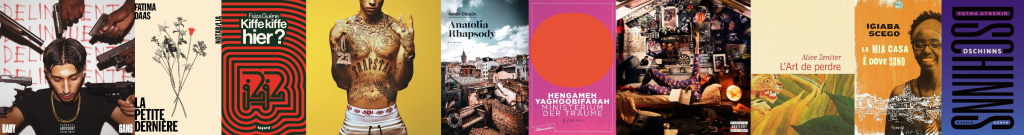
„Von gelebten Erfahrungen zu Erzählungen der Postmigration. Neugestaltungen von Selbst- und Welterzählungen in den pluralistischen Gesellschaften Europas“
Kolloquium (vom 17. bis 19. September 2025)
Der Begriff der Postmigration hat sich ursprünglich im deutschsprachigen wissenschaftlichen Diskurs entwickelt. Er wurde dann in der englischsprachigen und in der skandinavischen Kritik aufgegriffen, in der französisch- und italienischsprachigen Forschung wird er allerdings bisher wenig genutzt. Unmissverständlich stellt er eine Wende innerhalb der Migrationsdiskurse dar, insofern er in der Absicht, Migration als immanenten Bestandteil europäischer Gesellschaften zu betrachten, die Aufhebung der binären Opposition zwischen Migrant:innen und Nicht-Migrant:innen ermöglicht. Die Tagung „Von gelebten Erfahrungen zu Erzählungen der Postmigration“ versteht sich als Teil dieses laufenden epistemologischen und analytischen Prozesses und möchte untersuchen, wie die Postmigration dazu beiträgt, dass Erzählungen, die auf Erlebnissen und Erfahrungen mit Migration beruhen, überarbeitet und re- oder neu konstruiert werden. Im Fokus stehen Haltungen, Strategien, Dispositive und Narrative, die aus Herausforderungen, Verhandlungen, Konflikten, aber auch aus Bündnissen innerhalb europäischer Gesellschaften hervorgehen, die mit migrationsbedingter Vielfalt konfrontiert sind.
Die Tagung ist sich allerdings der unterschiedlichen Bedeutungen bewusst, die dem Begriff Postmigration zugeschrieben werden, und geht von einem breit gefassten Ansatz aus. Daher lädt sie dazu ein, über faktuale und fiktionale Lebensberichte postmigrantischer Personen nachzudenken, die als Nachkommen von Einwanderern keine direkte Migrationserfahrung gemacht haben. Darüber hinaus regt sie ebenso zur Untersuchung narrativer Texte an, die sich mit postmigrantischen, durch Einwanderung transformierten Gesellschaften befassen. Schließlich soll sie postmigrantische Perspektiven auf das Erzählen als eine Praxis eröffnen, die ihrerseits durch Einwanderung neu strukturiert wird.
Darüber hinaus möchte die Tagung den Dialog zwischen Künsten und Disziplinen fördern, die auf unterschiedliche Weisen daran arbeiten, die Spuren und Geschichten der Migration in den europäischen Gesellschaften zu erzählen und sichtbar zu machen. Aus komparatistischer Perspektive unterstützt sie den interdisziplinären Austausch entlang von Fallstudien, die sich Erzählungen der Postmigration in verschiedenen kulturellen und sprachlichen Kontexten (Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Skandinavien, Vereinigtes Königreich usw.) widmen.
Beiträge können dementsprechend aus unterschiedlichen Disziplinen, Künsten und Kulturen kommen und sollen sich mit postmigrantischen Selbst- und Welterzählungen befassen. Hierdurch können alle Dimensionen individuellen und kollektiven Erlebens umgefasst werden, die narrativ verarbeitet werden: Identität, Hybridität, Trauma oder Herausforderung/Probe gehören zu den Schlüsselbegriffen des Erzählens von Selbstverhältnissen; Verflechtungsgeschichte, Memory und Postmemory bieten Konzepte, die zur Analyse des jeweiligen Zeitbewusstseins herangezogen werden können. Das Raumverständnis kann anhand von Erzählungen privater und öffentlicher Orte erforscht werden, die Spuren der Migration tragen. Besondere Aufmerksamkeit gilt zudem der religiösen Dimension, die sowohl das Verhältnis zu sich als auch das Verhältnis zur Welt prägt. Über die hier genannten Ansätze hinaus sind zahlreiche weitere Perspektiven denkbar.
Ohne das breite Spektrum an möglichen relevanten Themen begrenzen zu wollen, sollten sich die einzelnen Beiträge einem der folgenden Schwerpunkte zuordnen lassen:
1. Literarische Erzählungen der Postmigration:
Dieser Schwerpunkt befasst sich mit den Formen und Inhalten, die das Erzählen von Postmigration in literarischen Gattungen und Poetiken annehmen kann. Untersucht werden sowohl kanonische Formen wie Roman, Autofiktion oder Autobiografie als auch neuere Erzählweisen wie Rap und Slam. Ziel ist es, die thematischen, semiotischen, pragmatischen, sprachlichen und narrativen Ressourcen zu analysieren, über die die jeweilige Textsorte verfügt, um spezifische Erlebnisse postmigrantischer Individuen oder Gesellschaften zu inszenieren und kritisch zu hinterfragen. Literarische Erzählungen können darüber hinaus als Laboratorien des Imaginären verstanden werden, in denen neue Konfigurationen von Identität, Erinnerung und Raum erprobt werden, die in den pluralistischen Gesellschaften der Gegenwart noch weitgehend im Entstehen begriffen sind. Schließlich können literarische Erzählungen als gegenhegemoniale Formen oder Werkzeuge der Anerkennung betrachtet werden, die den üblicherweise dominierten Stimmen Gehör verschaffen und so an der Etablierung einer neuen imaginierten Gemeinschaft arbeiten.
2. Visuelle Erzählungen der Postmigration:
Die Überlegungen beziehen sich hier auf künstlerische, kulturelle und mediale Produktionen, die dem Bild einen zentralen Platz in der Erzählung der Postmigration einräumen, etwa in Form von Filmen, Dokumentarfilmen oder fotografischen Erzählungen. Dabei soll untersucht werden, welche spezifischen Möglichkeiten das Bild bietet, um individuelle und kollektive Erfahrungen im Kontext von Migration darzustellen und zu vermitteln. Analysiert werden auch Techniken wie Komposition oder Montage, die es ermöglichen, Geschichten von Individuen oder postmigrantischen Gesellschaften in Europa zu erzählen. Besondere Aufmerksamkeit gilt Erzählungen, die die Spuren der Migration im urbanen Raum sichtbar machen und so die Orte dazu bringen, die oftmals ungehörte Geschichte zu erzählen, die sie von der Einwanderung nach Europa bewahren.
3. Postmigrantische Erzählungen in sozialwissenschaftlichen Feldstudien:
Dieser Schwerpunkt wird sich mit den Untersuchungsmethoden in der Anthropologie und Soziologie befassen, die es Einwanderern und deren Nachkommen ermöglichen, aus einer „entmigrantisierten“ Perspektive von sich selbst zu erzählen. Beiträge können sich mit narrativen Formen befassen, die dazu beitragen, die Erfahrungen der Befragten als eine den europäischen Gesellschaften immanente Komponente zu erfassen. In Frage kommen insbesondere wissenschaftliche Erzählungen, die anhand von konkreten Lebensläufen europäische Geschichten und Identitäten durch die Integration kultureller Referenzen – etwa des Islams – in einem pluralistischen Horizont neu definieren, in dem diese nicht länger als fremd wahrgenommen werden.
4. Historische Erzählungen der Postmigration:
In diesem Schwerpunkt wird untersucht, wie die Postmigration es ermöglicht, Gegendiskurse zu den vorherrschenden Formen nationalgeschichtlicher Narrative zu produzieren. In diesem Sinne und insbesondere im Anschluss an Duncan S. A. Bells Arbeiten zum „mythscape“ (2003) wird ein besonderes Interesse den Bedingungen des Schreibens und der Rezeption einer transnationalen und vernetzten Geschichtsschreibung gelten, die es gestatten, über die Entstehung und Entwicklung postmigrantischer europäischer Gesellschaften zu berichten.
5. Postmigrantische Erzählungen und Bildung:
In dieser Sektion wird untersucht, wie der Einsatz von Geschichten dazu beitragen kann, die pädagogischen Herausforderungen zu bewältigen, die der Multikulturalismus im Klassenzimmer in den postmigrantischen europäischen Gesellschaften mit sich bringt. Außerdem sollen innovative Unterrichtsaktivitäten und -dispositive erforscht und beschrieben werden, durch die Schülerinnen und Schüler sowie Studierende persönliche Geschichten teilen können, die tief mit der Migration und der Vielfalt des kulturellen und religiösen Erbes verknüpft sind. Ziel ist es, neue Wege des Lernens und Verstehens zu fördern, die die pluralistischen Realitäten europäischer Gesellschaften widerspiegeln.
6. Postmigrantische Erzählungen und Engagement:
Wie kann das Erzählen als eine Form des Engagements angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen, die mit der Pluralität des kulturellen und religiösen Erbes verbunden sind, aufgefasst werden? Wie können Individuen bestimmte Aspekte ihres persönlichen oder kollektiven Erlebens, etwa in Bezug auf persönliche Entwicklung, körperbezogene Fragen, politische Stellungnahmen usw., nutzen, um ihren spezifischen Standpunkt auszudrücken?
Zudem wird in Betracht gezogen, auf welche Weise Erzählungen das Engagement ihrer Autor:innen zum Ausdruck bringen. Daneben wird von Interesse sein, wie Erzählungen die Werte und Überzeugungen der Erzähler:innen widerspiegeln und inwiefern sie als Mittel der Selbstdarstellung oder des sozialen Protests fungieren können.
7. Postmigrantische Erzählungen und Rezeption:
Wie bereiten Postmigrationsberichte ihre eigene Rezeption vor und wirken aktiv an deren Gestaltung mit? Beiträge können erforschen, wie Erzählungen mit dem Erwartungshorizont des Empfängers spielen, indem sie etwa auf Stereotype und Gattungskonventionen rekurrieren. Daneben soll hinterfragt werden, wie die Erzählung als kommunikativer Akt konstruiert wird, um eine Botschaft zu vermitteln, die ihren pluralistischen Äußerungskontext berücksichtigt. Weiterhin kann das von der jeweiligen Erzählung konstruierte Bild des Empfängers untersucht werden sowie – in Verbindung mit dem vorherigen Schwerpunkt – die Art des Engagements, das sie bei ihrem impliziten Adressaten hervorzurufen versucht.
Das Kolloquium findet vom 17. bis 19. September 2025 an der Katholischen Universität Louvain (UCLouvain in Louvain-la-Neuve, Belgien) statt.
Die Vorträge können auf Englisch, Französisch, Deutsch oder Italienisch gehalten werden. Vorschläge, die aus einem Titel, einem Abstract (ca. 300 Wörter) und einer kurzen bio-bibliographischen Notiz bestehen, sind bis zum 30. April 2025 an Amaury Dehoux (amaury.dehoux@uclouvain.be), Hubert Roland (hubert.roland@uclouvain.be) und Gloria Coscia (gloria.coscia@uclouvain.be) zu senden.
Es können auch Panels vorgeschlagen werden. Wir bitten den Organisator/die Organisatorin des Panels, uns ein Dokument mit dem Titel und dem Programm des Panels, einem Abstract für jeden Vortrag (ca. 300 Wörter) und einer bio-bibliografischen Darstellung aller Teilnehmer:innen zukommen zu lassen. Auch in diesem Fall sind die Vorschläge bis zum 15. April 2025 an Amaury Dehoux (amaury.dehoux@uclouvain.be), Hubert Roland (hubert.roland@uclouvain.be) und Gloria Coscia (gloria.coscia@uclouvain.be) zu senden.
Die Antworten auf alle Vorschläge erfolgen bis zum 15. Mai 2025.
